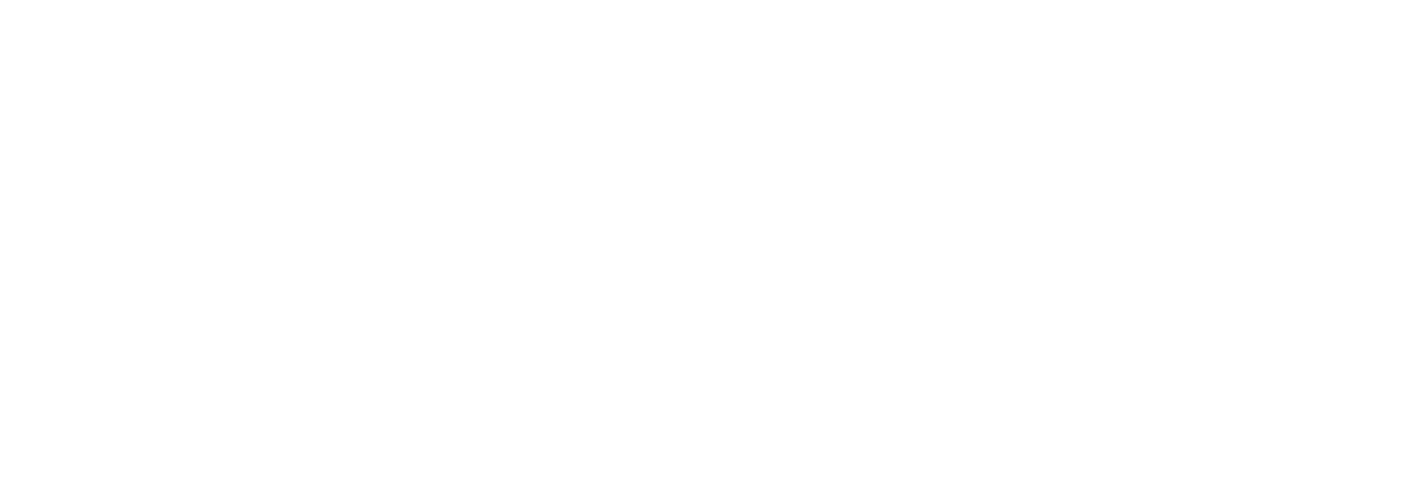Wer dem Wurm hilft, hilft sich selbst
Der Regenwurm ist ein Indikator für einen fruchtbaren Acker. Doch Wurm ist nicht gleich Wurm. Es gibt unterschiedliche Arten, die sich in Lebensart und Nutzen für den Landwirt deutlich unterscheiden.
Bis zu 20 Tonnen Mikroorganismen und Bodentiere leben auf einem Hektar fruchtbarem Boden. Rund bis zu zwei Tonnen – also zehn Prozent – davon nehmen die unterschiedlichsten Regenwürmer ein. In Mitteleuropa sind 60 unterschiedliche Arten bekannt. Auf landwirtschaftlichen Böden sind jedoch nur rund zehn Arten – an einzelnen Standorten noch weniger. Die Regenwürmer sind Zwitter, sie legen Eier, die durch einen Kokon geschützt sind, in dem sich die Jungen entwickeln. Pro Jahr sind dies eine bis zwei Generationen. Sie ernähren sich von abgestorbenen Pflanzen und Wurzelresten, die sie zusammen mit mineralischen Bodenbestandteilen aufnehmen und als Regenwurmkot wieder ausscheiden. Unter den Bodenarten bevorzugen die Regenwürmer mittlere bis schwere Böden, die eine schwach saure bis neutrale Bodenreaktion aufweisen. Unter den Regenwurmtypen finden wir in landwirtschaftlichen Böden fast ausschließlich Mineralbodenbewohner und Tiefgräber.
Tief graben
Der bekannteste Regenwurm, der „Tauwurm“ ist ein ausgesprochener Tiefgräber. Den Hauptgang gräbt er bis in eine zuverlässig feuchte Bodenschicht. Er kann bis in drei Meter Tiefe reichen und verzweigt sich zur Erdoberfläche hin in mehrere Ausfuhröffnungen. Durch den beim Graben ausgeübten Druck entsteht eine stabile Röhre, die der Wurm mit Schleimstoffen und Kot auskleidet und mehrere Jahre bewohnt. Durch verdichtete Bodenschichten frisst sich der Tauwurm regelrecht hindurch. Als Nahrung bevorzugt er Pflanzenreste, die er von der Bodenoberfläche in feuchte Bereiche seiner Wohnhöhle einzieht. Hier werden diese Reste erst von Mikroorganismen vorverdaut. Diese vorverdauten Reste nimmt der Wurm dann mit dem Boden auf. Den Kot scheidet er überwiegend an der Bodenoberfläche aus. Eine hohe Population mit teilweise mehr als 100 Wurmröhren/m2 kann pro Jahr über 50 t Kot produzieren und so den Boden umschichten. Verlassene Röhren nutzen die Pflanzenwurzeln, um tiefer in den Boden zu gelangen und Wasser- und Nährstoffe aufzunehmen. Bei einem hohen Besatz an Tauwürmern, mit vielen intakten Röhren, können Unmengen an Wasser – zum Beispiel bei lang anhaltendem Regen – rasch im Boden versickern.
Oberflächennah wühlen
Die häufigsten Regenwurmarten sind die Mineralbodenbewohner in Form der endogäischen Horizontalgräber. Sie leben bevorzugt in einer Bodentiefe bis ca. 15 cm und sind wie der Tauwurm empfindlich gegen Bodenversäurung, kommen aber mit Sandböden zurecht. Der bekannteste Vertreter ist in Ackerböden der
Gemeine Regenwurm oder Grauwurm, Aparreclodea caliginoss. Er legt keine dauerhaften Gänge an, sondern frisst sich durch den Boden, verdaut die darin enthaltene organische Substanz und füllt den Gang wieder mit seinem Kot. Er hält sich bevorzugt in der Nähe der Wurzeln auf, wo er sich von abgestorbenen Feinwurzeln, Wurzelhaaren samt den Wurzelausscheidungen und den dort lebenden Mikro-Organismen ernährt. Mit der Spatenprobe kann man die unregelmäßig verteilten Regenwurmkrümel im Oberboden sehr gut erkennen.
In Laborversuchen wurde ermittelt, dass ein ein Gramm schwerer Grauwurm ro Tag einen halben Meter Gang gräbt un dabei vier Gramm Kot ausscheidet. Bei einer Biomasse von 60 g/m2 (600 kg/ 11a) entspricht dies einer Strecke von 30 m Regenwurmgängen/m2 und 240 g ausgeschiedenem Regenwurmkot/ Tag. In die Praxis übertragen wären das bei 100 aktiven Tagen im Jahr 240 t Regenwurmkot/ha. Wenn auch nur, die Hälfte erreicht wird, ist das ein gigantisches Potenzial wenn man bedenkt, dass dieser Kot ein Mehrfaches der Nährstoffkonzentration wie der umgebende Boden aufweist. Die Kotkrümel sind regenstabil und werden von den Feinwurzeln durchdrungen. Gegenüber der Bodenbearbeitung ist der Grauwurm nicht so empfindlich wie der Tauwurm.
Seine Eikokons legt er am Rand der Gänge im Boden ab. Sie sind das wirksamste Stadium der Verdauerung, aus dem sich eine Regenwurmpopulation nach einem Zusammenbruch Wiederentwickeln kann. Eine Massenvermehrung können Sie beispielsweise an den absterbenden Wurzeln unter einer abgefrorenen Zwischenfrucht im Frühjahr beobachten. Bei Austrocknung des Bodens und Abkühlung durch Frost stellt der Graunmrm seine Aktivität ein, entleert den Darm, rollt sich in einer Kammer im Boden zu einem Knäuel ein und verfällt in einen Ruhezustand.