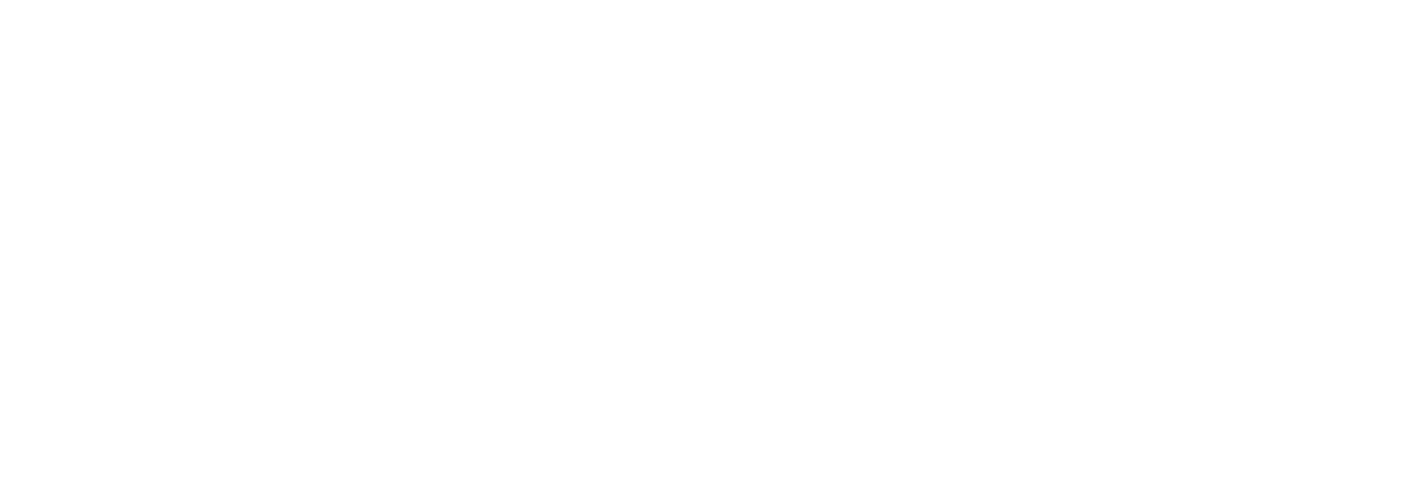Das Klimaabkommen von Paris
Frankreichs Außenminister, Laurent Fabius, präsentierte am 12. Dezember 2015 den endgültigen Entwurf des Pariser Klimavertrages. Das Ziel der Pariser Verhandlungen war es, den ersten weltweit bindenden Klimavertrag überhaupt abzuschließen.195 Staaten und die EU haben ein Abkommen beschlossen, das ab 2020 gilt und alle einbindet. Alle Staaten verpflichten sich, den Ausstoß von Kohlendioxid zu beenden. Dafür haben sie zwischen 40 und 70 Jahre Zeit.
Alle wichtigen Punkte im Überblick:
Begrenzung der Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad
In Artikel 2 des Vertrags verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten, die Erderwärmung auf bedeutend weniger als zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Zudem wollen sie sich bemühen, den Temperaturanstieg wenn möglich unter 1,5 Grad zu halten. Dass das 1,5-Grad-Ziel es in den Klimavertrag geschafft hat, ist ein großer politischer Erfolg für die durch den Klimawandel besonders bedrohten Inselstaaten, die sich stark dafür eingesetzt hatten. Unterstützt wurden sie darin von einer Koalition von Industrieländern. Das Ziel soll den hohen Anspruch des Vertrags verdeutlichen, hat aber eher symbolische Wirkung. Es zu erreichen, würde sofortige radikale Veränderungen in der globalen Wirtschaftsweise erfordern und gilt daher als unrealistisch. Zum Vergleich: Sollten alle beteiligten Länder tatsächlich die Klimaschutzvorgaben erfüllen, die sie im Vorfeld des Gipfels veröffentlicht haben, würde das die Erwärmung gerade einmal knapp unter drei Grad halten.
Senken der Treibhausgasemissionen
Das Ziel zum völligen Verzicht auf fossile Brennstoffe bis zum Ende des Jahrhunderts, hat es nicht in den Vertrag geschafft, auch nicht in der abgeschwächten Form. Schwellenländer wie Indien und China, Ölstaaten wie Saudi-Arabien, aber auch europäische Länder wie Polen, deren Wirtschaft stark an der Kohle hängt, stellten sich quer. Auch ein klares Datum, von dem an die globalen Treibhausgasemissionen sinken sollen, ist nicht mehr Teil des Vertrags. Übrig geblieben ist die vage Verpflichtung, dass sich alle Staaten bemühen sollen, „so schnell wie möglich“ den Punkt zu erreichen, an dem ihre Treibhausgasemissionen zumindest nicht weiter steigen. Zudem soll die Reduktion der Emissionen so erfolgen, dass sie mit wirtschaftlicher Entwicklung und Armutsbekämpfung vereinbar ist – ein klares Zugeständnis an die großen Schwellenländer, denen diese Klausel besonders am Herzen lag.
Überprüfung der nationalen Klimaziele alle fünf Jahre
Anders als befürchtet, ist der Mechanismus zur regelmäßigen Überprüfung der nationalen Klimaziele nicht aus dem Vertrag geflogen. Das ist ein wichtiger Erfolg, denn ohne einen Weg, die Ziele regelmäßig zu kontrollieren und zu erhöhen, wäre der Vertrag kaum etwas wert gewesen. Von 2023 an sollen unabhängige Experten nun alle fünf Jahre überprüfen, inwieweit einzelne Länder die vereinbarten Zusagen erfüllt haben. Zudem sollen alle Staaten einschätzen, ob sie nicht schon vorher ehrgeizigere Ziele vorlegen können. Das ist entscheidend, damit überhaupt eine Chance besteht, die weltweite Erwärmung unter zwei Grad zu halten. Die Klimaziele, die von den Staaten bisher vorgelegt wurden, reichen nämlich noch lange nicht aus, das oberste Ziel des Vertrags zu erreichen, die Begrenzung der Erwärmung auf weniger als zwei Grad.
Industrieländer hauptverantwortlich für die Finanzierung
Der Vertragstext enthält wortreiche finanzielle Zusagen der Industriestaaten an die Entwicklungsländer. Sie sollen großzügige Unterstützung erhalten, sowohl für die Bekämpfung des Klimawandels als auch für die Anpassung an dessen Folgen. Konkrete Zahlen sind allerdings aus dem Text verschwunden. Bisher wurden als Mindestbetrag 100 Milliarden Dollar Hilfen pro Jahr angepeilt. Die Zahl findet sich nun nur noch im Begleittext des Vertrags. Geblieben ist die Zusicherung der Industrieländer, die Hauptverantwortung für die „Mobilisierung“ der Klimafinanzierung zu übernehmen. Sie sollen regelmäßig Rechenschaft darüber ablegen, wie viel Geld sie zur Verfügung stellen werden. Auch die umstrittene Klausel, die anerkennt, dass vor allem Entwicklungsländer schon jetzt mit „Verlusten und Schäden“ aus dem Klimawandel zu kämpfen haben und für den Umgang damit Unterstützung benötigen, hat es in den Vertrag geschafft – wenn auch in abgeschwächter Form: Die Feststellung der „Haftung“ der Industrieländer für solche Schäden, die sich einige Entwicklungsländer gewünscht und die vor allem die Vereinigten Staaten von Anfang an abgelehnt hatten, kommt nicht mehr vor. Die Schwellenländer sind bezüglich der Finanzierung aus dem Schneider. Anders als von den Industrieländern gefordert, müssen sie keine konkreten Finanzzusagen machen, sondern können sich freiwillig an der Unterstützung der Entwicklungsländer beteiligen. Im Gegenzug ist ihre Forderung nach einer Klausel, in der die Industrieländer die historische Verantwortung für den Klimawandel übernehmen, aus dem Text verschwunden.
Als erstes Klimaabkommen überhaupt für fast alle Staaten auf der Welt verbindlich
Bis zum Schluss der Pariser Verhandlungen gab es immer wieder Sorge, dass der Gipfel statt mit einem bindenden Vertrag mit vagen Absichtserklärungen enden könnte – wie die Vorgängerveranstaltung im Jahr 2009 in Kopenhagen, die allen Teilnehmern als grandioses Versagen in Erinnerung geblieben ist. Der nun vorgestellte Vertragsentwurf hat nach Einschätzung vieler Beobachter allerdings beste Chancen, verabschiedet zu werden, so dass den Staatschefs eine Blamage wie in Kopenhagen erspart bleibt. Darauf deuteten auch die selbstbewussten Auftritte hin, die Frankreichs Außenminister Laurent Fabius, Staatspräsident François Hollande und UN-Generalsekrtär Ban Ki-Moon bei der Präsentation des Vertragsentwurfs absolvierten. Der Text sei differenziert, fair und völkerrechtlich bindend und erfülle das Verhandlungsmandat der beteiligten Staaten, sagte Fabius. Allerdings tritt er im Jahr 2020 nur unter der Bedingung in Kraft, dass ihn bis dahin mindestens 55 Staaten ratifizieren, die gemeinsam mindestens 55 Prozent der weltweiten Emissionen verantworten. Sollten sich wenige große CO2-Produzenten gegen die Ratifizierung entscheiden, würde das den Vertrag kippen.