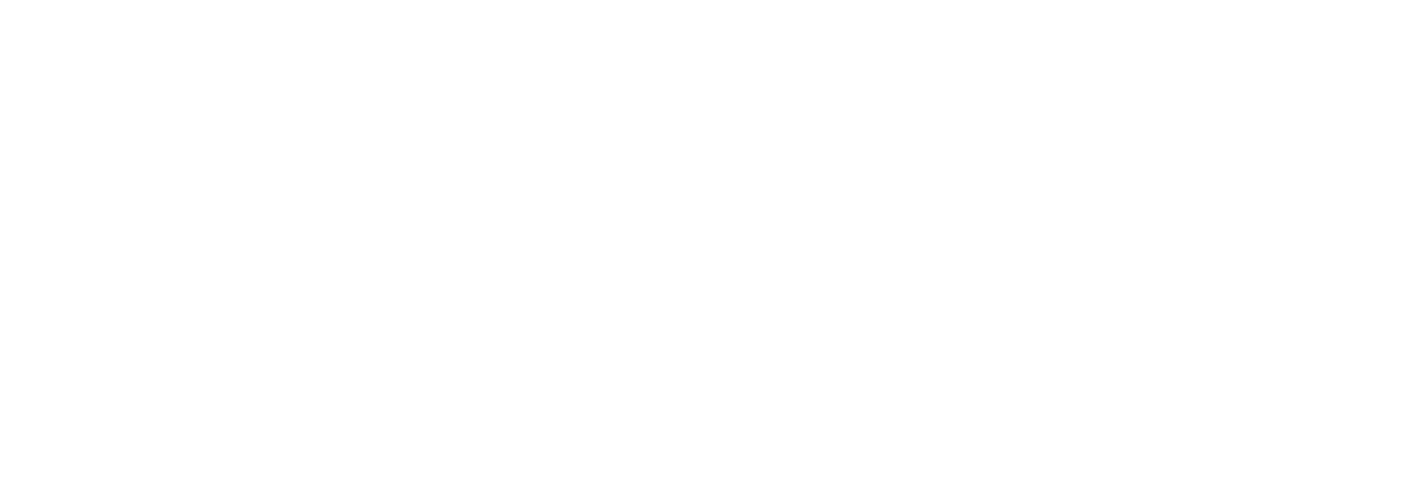Die Wölfe kehren nach Österreich zurück – schießen oder schützen?
Jäger und Bauern befürchten durch die Rückkehr der Wölfe eine Bedrohung für die Almwirtschaft, Naturschützer freuen sich. In Österreich gibt es derzeit zwar erst zehn Wölfe, die Debatte wie viel Wölfe das Land verträgt, ist jedoch groß.
Kaum ein Thema hat in den letzten Jahren unter Landwirten, Jägern und Naturschützern so polarisiert wie die Rückkehr des Wolfes. Wie auch immer man dazu stehen mag: Die Realität ist, dass sich Wölfe in Europa wieder ausbreiten und vermehren. Nirgendwo auf der Welt wachsen die Wolfsbestände schneller als in Mitteleuropa. Dafür ist vor allem die breite Unterschutzstellung dieses Tieres verantwortlich, die in den 1970er-Jahren begonnen hat. Ein weiterer begünstigender Faktor für die abermalige Ausbreitung des großen Beutegreifers ist die wieder angewachsene Schalenwildpopulation auf europäischem Boden. Ende des 19. Jahrhunderts, als der Wolf seinen Tiefpunkt erlebte, waren weite Teile Europas auch wildfrei. Wölfe verfügen außerdem über einen bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit und ein großes Vermehrungspotential. Auf der Suche nach neuen Lebensräumen und einem Partner verlassen ein- bis zweijährige Jungtiere ihr Rudel. Wölfe sind sehr ausdauernd. Sie legen auf Wanderschaft gewaltige Wegstrecken von einigen hundert Kilometern zurück. Derzeit leben in Europa etwa 10.000 Wölfe.
Wölfe in Niederösterreich
Seit dem vergangenen Jahr gibt es erstmals wieder ein Wolfsrudel in Österreich – am Truppenübungsplatz Allensteig in Niederösterreich. Etwa zehn Wölfe soll es derzeit in Österreich geben – genau kann man es nicht sagen. Laut Georg Rauer, Wolfsbeauftragter und Bärenanwalt, weiß man von acht Wölfen in Österreich sicher – dem Rudel in Allensteig und einem weiteren im Burgenland. Es könnten bald ein paar mehr werden, denn in Allensteig werden derzeit zum zweiten Mal Junge erwartet.
In Niederösterreich sucht man jetzt gemeinsam nach Strategien im Umgang mit dem Wolf. Einig ist man sich schon einmal darüber, dass es einen breiten Dialog mit allen Interessenvertretern braucht: der Jägerschaft, der Landwirtschaft, dem Naturschutz und dem Tourismus.
„Der Wolf beeinflusst sein Umfeld. Er ist ein verändernder Faktor für unsere Kulturlandschaft. Natürlich verändert er auch unsere Landnutzung und hat Einfluss auf unsere Wirtschaftsweise. Jedenfalls ist bei der Findung von Lösungsansätzen wichtig, neben Natur- und Artenschutz auch Faktoren wie Sicherheit für den Mensch und Tier in die Betrachtungen einfließen zu lassen.
Praktikables Wollfsmanagement
In Niederösterreich haben einzelne Wölfe bereits 2007 Schafrisse auf sich aufmerksam gemacht und für Schaden und Unsicherheit bei Landwirten gesorgt. In diesem Jahr wurden laut Wolfsexperte Rauer Ende Mai in der Nähe von Bad Traunstein (NÖ) sieben Lämmerrisse gemeldet. Weitere Rissmeldungen gibt es nicht.
Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich fordert, dass die Haltung von Vieh auf der Weide in allen Regionen weiterhin wirtschaftlich und ohne Gefährdung der persönlichen Sicherheit möglich sein muss. Schutzmaßnahmen durch Zähnung oder Herdenschutzunde sind teuer und selten möglich. Die Vertreter der Landwirtschaftskammer wollen ei praktikables Wollfsmanagement, die Unterstützung der betroffenen Grundeigentümer bei Herdenschutzmaßnahmen und Wolfsrissen sowie erforderlichenfalls entsprechende Maßnahmen zur Bestandsregulierung. Versprechen wollen sie im Strategieprozess vor allem die Unterstützung für betroffene Landwirte. Hilfe beim Herdenschutz, Aufklärungsarbeit, die Finanzierung von Hirten- und Herdenschutzhunden sind die zentralen Themen. Wichtig seien außerdem eindeutig geregelte und faire Schadenabgeltungen sowie klare gesetzliche Rahmenbedingungen. Begrüßen würde man der bundesländerübergreifende gesetzliche Grundlagen sowie einen Diskussionsprozess auf europäischer Ebene.
Entschädigung für Landwirte
Der Wolf ist in NÖ eine nicht jagdbare Wildart, die Schutz in Form einer ganzjährigen Schonzeit genießt Einen Eindruck davon was die niederösterreichische Jägerschaft über die Wiederkehr des Wolfes denkt, erhielt man bereits beim Landesjägertag im April in Ziersdorf. „Wir wehren uns gegen das gezielte Aussetzen und Ansiedeln“, so Landesjägermeister Josef Kröll. Aber alles, was natürlicher Zuzug ist, müsse gemanagt und beobachtet werden, dafür werde man sich einsetzen. Es gehe nicht darum, das Tier wieder auszurotten, sondern in vernünftigen Bahnen zu behandeln. Daher binden sich die Vertreter der Landesjägerschaft auch in die aktuelle Strategierunde ein. Um die fachliche Diskussion über den Wolf und über ein notwendiges Management, das jedenfalls auch die Entnahme von Wölfen zum Inhalt haben muss, zu ermöglichen, wünscht der Niederösterreichische Landesjagdverband jetzt sofort ein faires Entschädigungsmodell für Land- sowie Weidewirte. Dieses soll rasch und unbürokratisch zu Ersatzleistungen an die durch Bär, Wolf oder Luchs Geschädigten führen. Dabei sei es wichtig auch das Land einzubinden, um die Kosten so gering wie möglich zu halten.
Der Grauwolf
Merkmale
Von der Gestalt und Größe ähneln Wölfe hierzulande Schäferhunden. Europäische Grauwölfe werden zwischen 100 und 140 Zentimetern lang, haben eine Schulterhöhe von 60 bis 90 Zentimeter und wiegen 28 bis 38 Kilogramm. In seinem europäischen Verbreitungsgebiet ist das Wolfsfell grau bis bräunlich. Wölfe erkennt man hierzulande an ihren dreieckigen Ohren, einer hellen Gesichtspartie, einem dunklen Sattelfleck und einem meist hängenden Schwanz. Außerdem sind Wölfe sehr hochbeinig; ihr gesamter Körperbau ist für ausdauernde Wanderungen gut ausgelegt. Untersuchungen in Deutschland haben gezeigt, dass Wölfe täglich rund 40 Kilometer zurücklegen.
Sozialverhalten und Fortpflanzung
Wölfe sind soziale Tiere und leben im Familienverbund, dem Rudel. Zum Wolfsrudel gehören neben den Eltern und ihren Welpen auch Nachkommen aus dem Vorjahr, die sogenannten Jähr- linge. Werden sie in ihrem zweiten oder dritten Lebensjahr geschlechtsreif, wandern sie auf der Suche nach einem eigenen Revier und eigenen Partner aus dem elterlichen Territorium ab. Eine strikte Rangordnung wie sie aus der Gefangenschaft gelegentlich beschrieben wird, gibt es in der Natur nicht. Die Anzahl der Tiere pro Rudel ist von Region zu Region unterschiedlich, hierzulande beträgt sie in der Regel zwischen 8 und 12 Tiere. Jedes Rudel besitzt ein Revier, das es gegen andere Rudel verteidigt. Die Reviergröße hängt vom Nahrungsangebot ab.
Nahrung
Wölfe sind sogenannte Opportunisten und ernähren sich von den Beutetieren, die in der jeweiligen Region häufig sind. Bevorzugt sind das große Huftiere wie Rehe, Wildschweine oder Hirsche. Wölfe können sowohl im Rudel als auch alleine jagen und sind dabei in der Lage, gesunde ausgewachsene Tiere zu töten. Studien zeigen aber auch, dass kranke und schwache Tiere für den Wolf einfacher zu erbeuten sind. In manchen Regionen gehören auch Kleinsäuger wie Hasen, Kaninchen und Murmeltiere und manchmal sogar Früchte zum Speiseplan. Ungeschützte Hau- stiere, besonders Schafe und Ziegen können ebenfalls von Wölfen gefressen werden. Dabei tötet der Wolf manchmal mehr Tiere, als er sofort fressen kann, weil eingezäunte Nutztiere, die nicht flüchten eine unnatürliche Situation für den Wolf darstellen. Der sogenannte Beuteschlagreflex bewirkt, dass Wölfe mehrere Tiere töten um sie zu einem späteren Zeitpunkt aufzufressen. Der mittlere Nahrungsbedarf eines Wolfes beträgt etwa drei bis fünf Kilogramm Fleisch am Tag. Dabei ist das Verdauungssystem des Wolfes so ausgelegt, dass er in kurzer Zeit große Mengen zu sich nehmen kann und danach mehrere Tage kein Fressen benötigt.